Die angegebene Seite wurde leider nicht gefunden.
Sachsen und Anhalt. Jahrbuch der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt, Band 36/2024
Verloren, verwandelt, wiederentdeckt. Lost Places in Sachsen-Anhalt gemeinsam sichtbar machen
Großstadt und Reformation: Metropolen als Innovationsräume
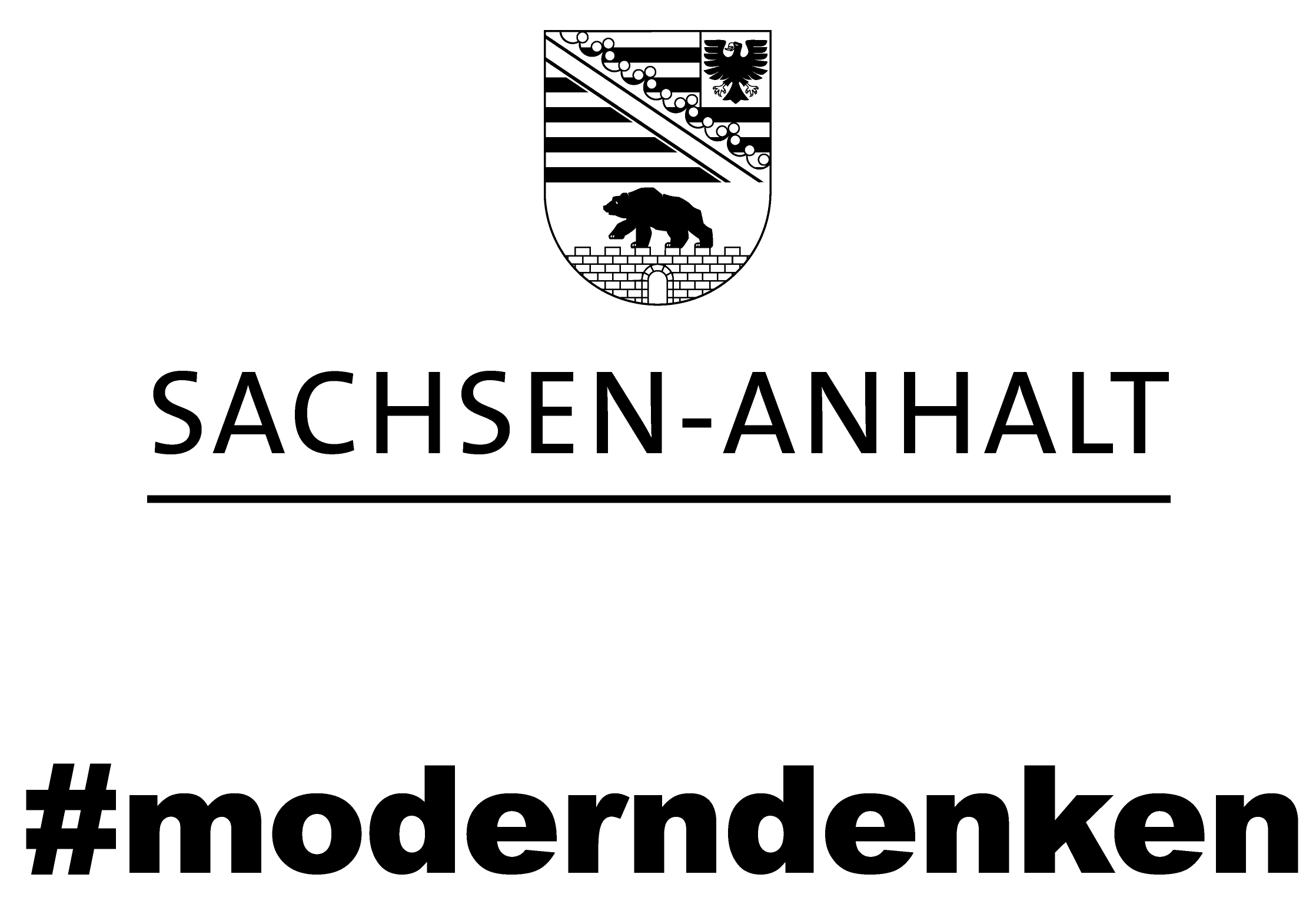
Historische Kommission für Sachsen-Anhalt
- Arbeitsstelle -
c/o Franckesche Stiftungen zu Halle
Franckeplatz 1, Haus 24
06110 Halle (Saale)
Tel.: (0345) 21 27 429
Mail: kontakt@hiko-sachsen-anhalt.de
Historische Kommission für Sachsen-Anhalt
- Arbeitsstelle -
c/o Franckesche Stiftungen zu Halle
Franckeplatz 1, Haus 37
06110 Halle (Saale)
Die angegebene Seite wurde leider nicht gefunden.