| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
| |
|
7
|
8
|
9
|
11
|
12
|
13
| |
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
| ||
|
21
|
22
|
23
|
27
| |||
|
28
|
29
|
30
|
31
| |||
Verloren, verwandelt, wiederentdeckt. Lost Places in Sachsen-Anhalt gemeinsam sichtbar machen
Tag der Landesgeschichte: Digital History & Citizen Science
Verketzerungsprozesse in Mitteldeutschland im Spätmittelalter und 16. Jahrhundert
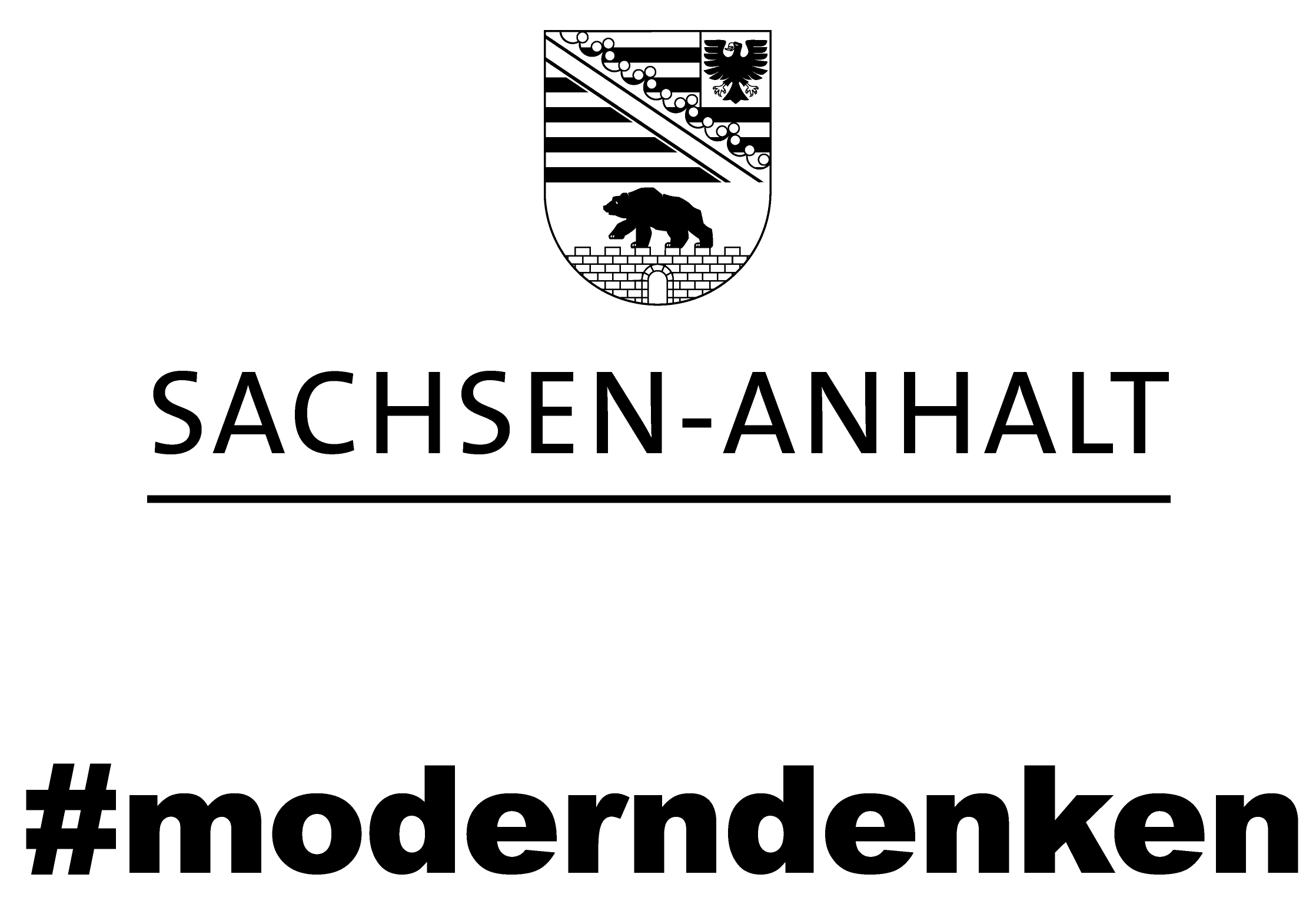
Historische Kommission für Sachsen-Anhalt
- Arbeitsstelle -
c/o Franckesche Stiftungen zu Halle
Franckeplatz 1, Haus 24
06110 Halle (Saale)
Tel.: (0345) 21 27 429
Mail: kontakt@hiko-sachsen-anhalt.de
Historische Kommission für Sachsen-Anhalt
- Arbeitsstelle -
c/o Franckesche Stiftungen zu Halle
Franckeplatz 1, Haus 37
06110 Halle (Saale)

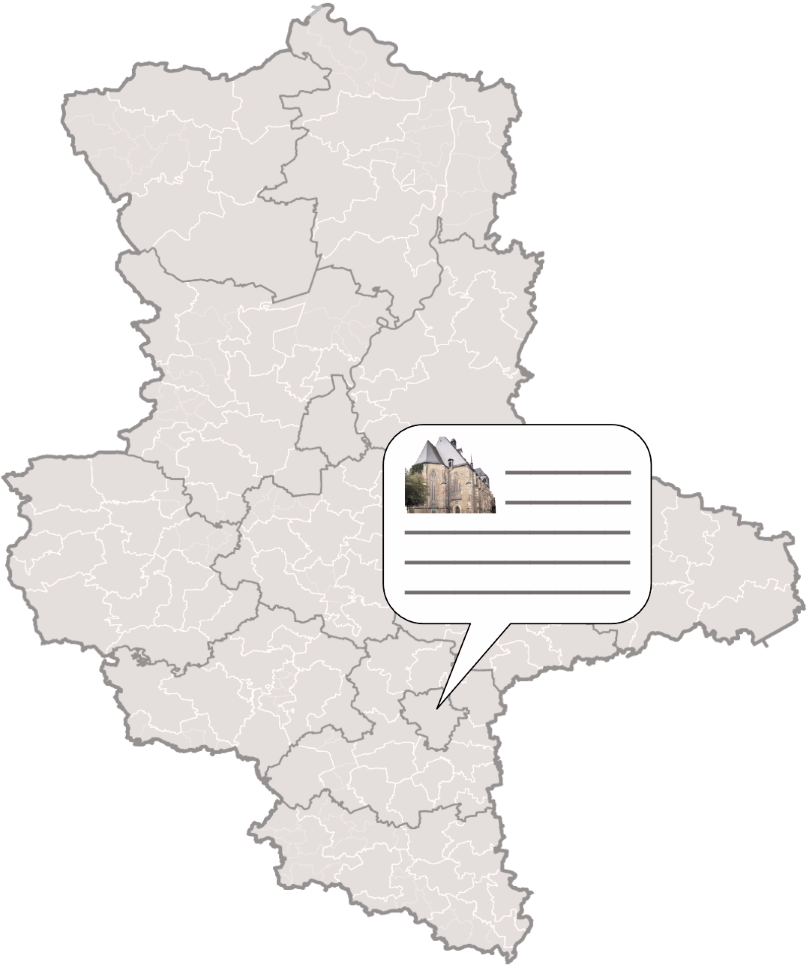 Unter diesem Titel ruft die Historische Kommission für Sachsen-Anhalt Schulen, Heimatvereine sowie alle geschichtsinteressierten Menschen in Sachsen-Anhalt dazu auf, in Vergessenheit geratene historische Orte, Gebäude und Einrichtungen in ihrer Umgebung zu erforschen.
Unter diesem Titel ruft die Historische Kommission für Sachsen-Anhalt Schulen, Heimatvereine sowie alle geschichtsinteressierten Menschen in Sachsen-Anhalt dazu auf, in Vergessenheit geratene historische Orte, Gebäude und Einrichtungen in ihrer Umgebung zu erforschen.
Anliegen des Public History-Projektes ist es zu zeigen, wie vielfältig die Geschichte Sachsen-Anhalts ist. Hierfür sammeln wir multimediale Beiträge, die in ganz unterschiedlicher Weise von den vergessenen Orten erzählen können. Die Ergebnisse dieser historischen Spurensuche sollen später auf einer digitalen Landkarte im Internet veröffentlicht werden.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich mit einem Beitrag beteiligen und/oder andere auf das Projekt aufmerksam machen. Weitere Informationen finden Sie hier.
 24.–26. Oktober 2024 in Stolberg
24.–26. Oktober 2024 in StolbergBei der Auseinandersetzung mit Thomas Müntzer und anderen Vertretern der „radikalen Reformation“ wird ein Phänomen eher selten beachtet: der Vorgang der „Verketzerung“ dieser Gruppierungen durch die etablierten Wittenberger Reformatoren. Luther und Melanchthon lenkten die Berichterstattung über Müntzer und die von ihm angeblich angestifteten Bauern bewusst so, dass das rigide Vorgehen gegen die Aufständischen aus religiöser Perspektive gerechtfertigt wurde. Die radikalen Ansichten und Aussagen ihrer Gegner sind dabei oftmals nur in Schriften der Reformatoren erhalten.
Dieses Verfahren, Konkurrenten jeglicher Art – politischer, sozialer, religiöser – durch Häresievorwürfe zu schädigen und in letzter Konsequenz auszuschalten, ist im 16. Jahrhundert jedoch keineswegs neu. Bereits im Mittelalter wurde es in verschiedenen Kontexten zur Anwendung gebracht.
Weitere Informationen und das Programm finden Sie hier.
zusammen mit dem Zentrum für Mittelalterausstellungen e.V., dem Kulturhistorischen Museum Magdeburg und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Restaurierungsmaßnahmen an Dom- und Stiftskirchen, Klosteranlagen, Burgen sowie sonstigen Profanbauten und deren Aushandlungsprozesse prägten im gesamten 19. Jahrhundert das Denkmalbewusstsein und formten Ideen und Grundsätze der im Entstehen begriffenen Denkmalpflege. Ziel der Tagung ist es, die Bedeutung der Restaurierungsprojekte des 19. Jahrhunderts in der preußischen Provinz Sachsen in ihren möglichst vielfältigen kulturgeschichtlichen, kunsthistorischen und wissenschaftsgeschichtlichen Zusammenhängen aufzuzeigen.
Die Veranstaltung wird in hybrider Form stattfinden. Die Teilnahme an der Tagung ist kostenfrei und mit vorheriger Anmeldung möglich. Bitte senden Sie Ihre Anmeldung bis zum 20. November 2024 per E-Mail an:
Weitere Informationen und das Programm finden Sie hier.
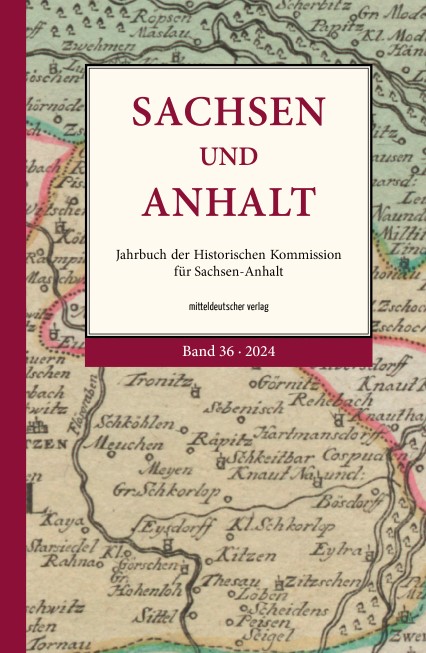 Sachsen und Anhalt. Jahrbuch der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt, Band 36/2024, im Auftrag des Instituts für Landesgeschichte am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt, herausgegeben von Michael Hecht, Jan Kellershohn, Margit Scholz, Michael Scholz und Bettina Seyderhelm.
Sachsen und Anhalt. Jahrbuch der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt, Band 36/2024, im Auftrag des Instituts für Landesgeschichte am Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie und der Historischen Kommission für Sachsen-Anhalt, herausgegeben von Michael Hecht, Jan Kellershohn, Margit Scholz, Michael Scholz und Bettina Seyderhelm.
Beiträge des 12. Tags der Landesgeschichte „Städtische und höfische Repräsentationskultur im Umfeld von Heinrich Schütz“ 2022 in Weißenfels eröffnen das Jahrbuch. Hinzu treten Aufsätze mit landeshistorischem Bezug wie „Die Magdeburger Chronik des Andreas Schoppius“, „Stiftungen und memoria am mittelalterlichen Augustinerchorherrenstift Hamersleben“, „Binationale Paarbeziehungen in den Bezirken Halle und Magdeburg der DDR“ oder „Weibliche Erwerbsarbeit und Frauenförderung im Mitteldeutschen Chemiedreieck während der DDR-Zeit“. Ein Werkstattbericht behandelt die Sonderausstellung „Welche Taten werden Bilder? Otto der Große in der Erinnerung späterer Zeiten“. Rezensionen zu aktuellen landesgeschichtlichen Veröffentlichungen beschließen den Band.